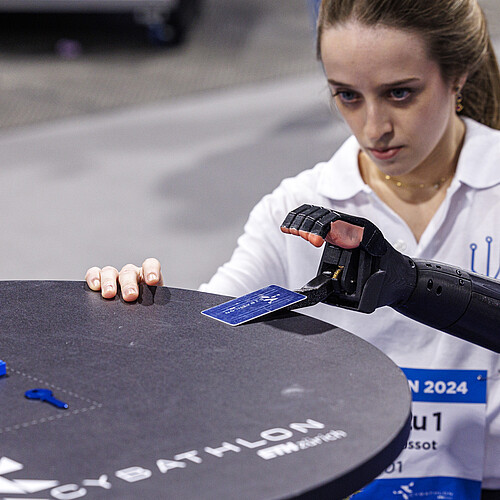- Fokus: Zukunft
Schwimmende Bauten – Siedlungen auf dem Wasser
Die steigenden Meeresspiegel bedrohen küstennahe Siedlungen weltweit. Liegt die Zukunft dieser Regionen in schwimmenden Bauten? Ein Blick auf Entwicklungen und Herausforderungen des Bauens auf dem Wasser.
11.02.2025

Seit jeher übt die Lage am Wasser eine besondere Anziehungskraft auf menschliche Ansiedlungen aus. Einige Kulturen haben dabei sogar den Schritt auf das Wasser gewagt. In Mesopotamien hatten die Marsch-Araber (Ma`dan) bereits vor 5000 Jahren damit begonnen, ihre Häuser auf künstlichen Schilfinseln zu errichten, und damit das Sumpf- und Marschland zwischen Euphrat und Tigris besiedelt. Dieser Kultur wurde durch Trockenlegung der Sümpfe die Grundlage entzogen. Bis heute leben aber beispielsweise in Peru die Uros auf kleinen schwimmenden Inseln im Titicaca-See, die an Eukalyptuspfählen verankert sind. Die Inseln boten früher Schutz vor Gefahren, im Falle einer Bedrohung konnten sie sogar verlegt werden. Ihre Unterhaltung erweist sich durch die Verwendung natürlicher Materialien, die schnell verrotten und faulen, allerdings als ausgesprochen aufwendig.

Verschiebung der Küstenlinien gefährdet bestehende Siedlungen
Heute bildet der Schutz vor Überflutung den Hauptgrund, eine Besiedlung der Wasseroberflächen in Erwägung zu ziehen. Insbesondere Städte an den Küsten des Indischen Ozeans sind von starken Bodenabsenkungen betroffen, die im Zusammenwirken mit einem klimabedingten Anstieg des Meeresspiegels hohe Risiken für die bestehenden Siedlungsräume beinhalten. Auch wenn sich diese Szenarien erst längerfristig auswirken werden, sind sie letztlich unaufhaltsam und erfordern vorausschauende Strategien für einen geordneten, sozial und wirtschaftlich verträglichen Massnahmenansatz. Bis zum Jahr 2100 wird die Anzahl der Menschen, die bei einer Verschiebung der Küstenlinien in einer Gefahrenzone von weniger als zwei Metern über dem Meeresspiegel leben, auf 410 Millionen geschätzt.
Anpassungen an die Natur sind nötig
Der Kampf gegen den Ozean ist vergebliche Liebesmühe. Die Anpassung an Veränderungen in der Natur ist somit unerlässlich. Es wäre ein schwerer Schritt, angestammte Küstengebiete aufzugeben, die für ihre Bewohnerinnen und Bewohner auch eine eng mit Traditionen verbundene Heimat darstellen. Somit bleibt als weitere Option, auf und am Wasser neue Siedlungsräume als Lebensraum für Menschen, aber auch als Acker- und Weideland zu schaffen, die sich an den steigenden Meeresspiegel und den naturräumlichen Gegebenheiten anpassen können. Daher sind Konzepte gefragt, die frühzeitig tragfähige Lösungen mit hoher Akzeptanz für Siedlungen und Infrastrukturen aufzeigen. In der Zukunft werden auf diese Weise beispielsweise Städte in Indonesien oder Vietnam in der Lage sein, die unvermeidlichen Herausforderungen in nachhaltige Wachstumschancen verwandeln.
Konstruktive und baurechtliche Herausforderungen
Bereits die historischen Beispiele zeigen den grundsätzlichen Aufbau schwimmender Siedlungen. Auf einer künstlichen Insel aus schwimmfähigen Materialien werden die Gebäude wie auf dem Land errichtet. Mehrere Inseln können dabei miteinander verbunden werden und somit auch einen grösseren Siedlungsbereich bilden. Daraus leiten sich aktuelle Bauweisen für geeignete Pontons ab, die das Grundgerüst und damit das Fundament für schwimmende Bauten bilden. Als Materialien für diese Konstruktionen finden bevorzugt Stahl und spezielle Betone oder Sandwichbauweisen Verwendung.

Für eine dauerhafte Nutzung ergeben sich einige grundlegende Herausforderungen, wie die Schwimmfähigkeit und Lagestabilität sowie die Verankerung des Pontons bzw. die sichere Verbindung der Pontons untereinander. Weiterhin sind betriebliche Anforderungen und Gewährleistung der Bauwerkssicherheit, des Brandschutzes und der Rettungswege einzuhalten. In einigen Ländern bestehen dazu bereits Richtlinien und Standards. Erst in Ansätzen ist der baurechtliche Status schwimmender Siedlungen geklärt. Dazu werden Abgrenzungen zu Schiffen und Hausbooten, die einen eigenen Antrieb besitzen und damit ortsunabhängig sind, sowie zu klassischen Gebäuden, die mit einem Fundament fest im Boden verankert sind, erforderlich.

Dalben minimieren Schwankungen
Wie ein Gebäude auf einem Landgrundstück eine feste und sichere Gründung mit einem Fundament benötigt, so bildet der Ponton die verlässliche Basis für darauf errichtete Bauten. Die auftretenden Lasten durch das Eigengewicht, aber auch seitliche Krafteinwirkungen, insbesondere durch den Wind, müssen aufgenommen und an den Unterbau abgegeben werden. Bereits kleinere Seen können bei starkem Wind einen beachtlichen Wellengang aufweisen. Die auftretenden Kräfte führen zu einem Drehmoment, das ein schwimmendes Gebäude aus der Gleichgewichtslage bringen könnte und die Stabilität des Pontons beeinflusst. Dies gilt es natürlich zu verhindern. Die Neigung der Konstruktion, also die Schräglage oder der Kränkungswinkel, ist auf wenige Grad zu begrenzen, um die normale Nutzung im Gebäude nicht merklich einzuschränken. Eine stabile Befestigung an im Boden gegründeten Dalben ist hierzu eine gängige Methode, die eine vertikale Bewegung der Konstruktion zulässt, aber eine Drehbewegung und Verwindung wirkungsvoll begrenzt. Eine solche Bauweise grenzt den Standort schwimmender Siedlungen sinnvollerweise auf Ufernähe bzw. flache Gewässer ein.
Dabei wirken sich die schwimmenden Siedlungen kaum störend auf die Umwelt aus; sie lassen dem Wasser seinen natürlichen Lauf. Teilweise bilden sie sogar neue und geschützte Lebensräume für Leben im Wasser (z. B. Muscheln) oder dienen als Rast- und Nistplätze für Vögel.

Energieversorgung durch Wind, Wellen und Wärme
Die Versorgung von schwimmenden Bauten und Siedlungen kann durch eine landseitige Anbindung erfolgen. Die Energieversorgung mit Strom und Wärme ist jedoch ebenso seeseitig über erneuerbare Energiequellen realisierbar. Damit lässt sich ein hohes Mass an Autarkie erreichen. Die Herausforderung besteht darin, eine integrierte kontinuierliche Energieversorgung zu schaffen. Das Umfeld bietet dazu ein breites Angebot über die Nutzung von Wasserkraft, Sonne, Wind, Wellenenergie und Wärmepumpe. Die marktreife Weiterentwicklung und die Untersuchung von autarken Energieversorgungssystemen gehören zu den wichtigsten Aufgaben für die nachhaltige Entwicklung schwimmender Siedlungen. Ein Beispiel für die Zukunft des Bauens auf dem Wasser lässt sich an einem Demonstrationsobjekt ablesen. Das Autartec-Haus am Bergheider See in Brandenburg zeigt die Möglichkeiten zur Entwicklung von Kompetenzen zu energieeffizienter Bauweise, zur Gestaltung hochfunktionaler Produkte und zur Umsetzung dauerhaft schwimmender Häuser, deren Entwurf energieautarkes Wohnen mit Lebenskultur im ästhetischen Raum kombiniert. Eine autarke Lebenskultur umfasst die zusammenhängenden Bereiche elektrische Energie, thermische Energie und wassertechnische Aufbereitung. Architektonisch spiegeln sich die jeweiligen Autarkiebereiche am Gebäude in seinem Erscheinungsbild wider, bei dem die äusseren Flächen für den spezifischen Energieertrag jeweils optimal ausgerichtet sind.
Ziel: vom Luxusobjekt zur bezahlbaren Lösung
Ein Auftrag für künftige Entwicklungen wird darin liegen, das technisch Machbare in einen wirtschaftlich tragbaren Kontext zu setzen. Bislang beschränken sich Projekte für zeitgemässe schwimmende Bauten auf kostenintensive Resorts für eine zahlungskräftige Klientel oder für Nutzungen in ausgefallener Urlaubs- und Freizeitumgebung. Die darüber gewonnenen Erkenntnisse werden sicherlich einmal in die «Serienfertigung» eingehen und dann auch dazu beitragen, kostengünstigere Lösungen in den Problemzonen der Welt für finanziell weniger belastbare Bevölkerungsgruppen zu realisieren.